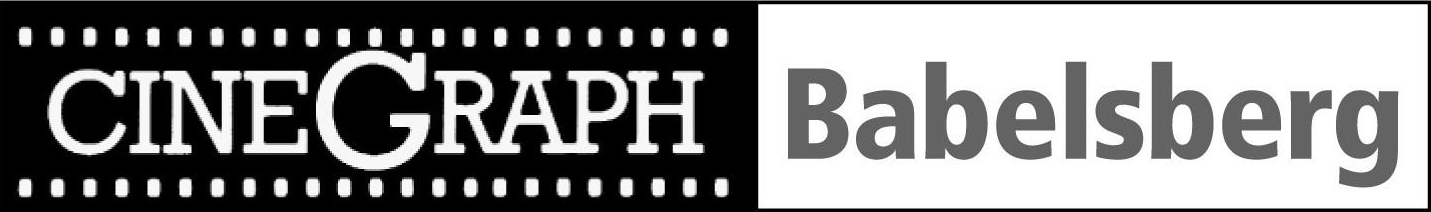Die Filmgeschichtsforschung in Deutschland hat in den vergangenen Jahren viele Informationen besonders über die Frühzeit des Kinos zutage gebracht und neben der Erweiterung unserer Kenntnisse auch stets Anreize für weitere Erkundungen mitgeliefert. Zur Weiterarbeit laden außerdem die vielen Querverbindungen ein, die sich hier fortlaufend auftun. Immer wieder zeigt sich dabei, wie nützlich und erkenntnisträchtig regionalgeschichtlich fokussierte Forschungen zu schmalen Kino-Feldern sein können. So empirisch sie im Einzelnen sein mögen, so sehr verlocken sie doch, mancherlei ihrer Ergebnisse „hochzurechnen“ oder mit anderen medialen Erscheinungen der Zeit ins Verhältnis zu setzen. Diese Eigentümlichkeit wird wohl auch künftig von Bedeutung sein, sie kann als reizvolle Herausforderung begriffen werden. Die vorliegende Filmblatt-Ausgabe bietet mit Ralf Forsters Aufsatz über den Zusammenhang von früher Filmtechnik, industrieller Produktion und Marktauswertung ein auf die sächsische Apparate-Industrie in Dresden konzentriertes Beispiel. Jutta Schäfers konzise Beschreibung eindrucksvoller Fundstücke aus dem Freiburger Stadtarchiv – Hausplakate, die Freiburger Kinobetreiber für ihre Außenwerbung anfertigen ließen – schlägt dazu eine originelle und aufschlussreiche Ergänzung vor. Man kann sicher sein, dass sich solche Funde auch in anderen regionalen (und privaten?) Archiven werden machen lassen.
Es mag nur wenig verwundern, dass es nicht an Versuchen fehlt, „frühe“ Kinosituationen für heute nachzustellen, stets begleitet von der Hoffnung, über den bloßen Event hinaus das wirkliche Funktionieren eines versunkenen Kommunikationsgeflechts zwischen Alltagsvergnügen und Jahrmarktsspektakel durchschmecken zu können. Brigitte Braun und Martin Loiperdinger berichten in ihrer engagierten Selbstanzeige von einem Pilotprojekt solcher Wiederbelebung, das die Cinémathèque de la Ville de Luxembourg und das Fach Medienwissenschaft der Universität Trier mit „Crazy Cinématographe“ veranstalteten. Dabei kam ihnen die öffentliche Aufmerksamkeit für Luxembourg als Kulturhauptstadt Europas 2007 zugute. Man kann neugierig sein, zu erfahren, ob das schillernde Experiment Nachfolger findet und welche Erfahrungen anderswo gemacht werden. Insbesondere wären genauere Erkenntnisse über Besucherreaktionen des „Volksfestpublikums“ von Wert. CineGraph Babelsberg und Filmblatt werden dafür auch künftig eine Plattform öffentlicher Verständigung bereithalten.
In anderen Teilen dieses Heftes schlagen sich weitere und vor allem kontinuierliche Aktivitäten und Interessen von CineGraph Babelsberg – bezogen auf einzelne Filme – nieder: Martin Loiperdinger referiert unter der durchaus ironisch gemeinten Überschrift „Ein deutsches Insekt“ über den Film DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER (1926) und durchleuchtet dessen Produktions- und besonders die Rezeptionsgeschichte, die weit über einen „Insektenfilm“ hinausgehen. Philipp Osten berichtet über (Berliner) Ärzte als Filmregisseure bei dem Ufa-Kulturfilm aus dem Berliner Oskar-Helene-Heim, KRÜPPELNOT UND KRÜPPELHILFE (1920), und ergänzt damit die aktuelle Berliner Medizingeschichtsschreibung um eine wissenswerte mediale Flanke. Jeanpaul Goergen schließlich charakterisiert Curt Oertels Film NEUE WELT (1954) schon in der Überschrift seines Textes „Vom Wigwam zum Wolkenkratzer“.
Philipp Stiasny schlägt in seinem Review Essay, angeregt durch sehr
unterschiedliche Publikationen der letzten Zeit, einen weiten Bogen über
Leben und Werk der bundesdeutschen Produzenten Arthur Brauner und Luggi
Waldleitner sowie des Schweizer Kinounternehmers Erwin C. Dietrich. Das
Spannungsfeld, das er aufmacht, also das Genrekino in der
Bundesrepublik „zwischen Mainstream und Nischenexistenz“, und die
beschriebenen Publikationen annoncieren weiteren Forschungsbedarf.
Schließlich besprechen Horst Claus, Tobias Ebbrecht, Ralf Forster, Uli
Jung, Jörg Schweinitz und Jens Thiel aktuelle Neuerscheinungen
filmhistorischer Literatur und Jürgen Kasten Günther Rühles Kompendium
Theater in Deutschland, 1887-1945.
Günter Agde, Berlin, den 11. Juli 2008